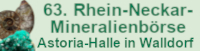Um unsere Informationen stetig vervollständigen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Bei uns kann und soll jeder mitmachen. Derzeit nutzen und erweitern 10467 Mitglieder den Mineralienatlas kontinuierlich. Jeden Monat nutzen hunderttausende Besucher unsere Webseite als Informationsquelle.
Geolitho Stiftung gemeinnützige GmbH ist der gemeinnützige Träger des Mineralienatlas, der Lithothek, der Geolitho-Sammlungsverwaltung und dem Marktplatz und Shop von Sammlern für Sammler. Die Stiftung fördert die Volksbildung auf dem Gebiet der Mineralogie, der Lagerstättenkunde, Geologie, Paläontologie und des Bergbaus durch das Betreiben, den Erhalt und weiteren Ausbau erdwissenschaftlicher Projekte.
| Die Viloco Mine liegt hoch über der Ortschaft Viloco auf bis zu über 4900m. Die Mine zieht sich dabei über mehrere hundert Meter entlang des Berges in die Höhe. Sie befindet sich im "Cordillera Quimsa Cruz" (Aymara-Sprache) oder "Kimsa Krus" (Quechua-Sprache) oder auch "Tres Cruces" (deutsch "drei K ... mehrDie Viloco Mine liegt hoch über der Ortschaft Viloco auf bis zu über 4900m. Die Mine zieht sich dabei über mehrere hundert Meter entlang des Berges in die Höhe. Sie befindet sich im "Cordillera Quimsa Cruz" (Aymara-Sprache) oder "Kimsa Krus" (Quechua-Sprache) oder auch "Tres Cruces" (deutsch "drei Kreuze") genanntem Gebirgszug im Departamento La Paz. Zahlreiche Stolleneingänge und meist verfallene Bergwerksbauten zeugen von einer umfangreichen Bergbautätigkeit. Verschiedene Quellen schreiben auch von Araca Mine, der Name sei quasi austauschbar. Hierbei handelt es sich um einen historischen Namen. |
| Der Schacht 371 der ehemaligen SDAG Wismut befindet sich östlich der Straße zwischen Niederschlema und Hartenstein an dem großen Doppel-Bogen der Zwickauer Mulde. In der Nähe befindet sich das bekannte Ausflugsziel "Prinzenhöhle". Das Schachtgelände einschließlich der mächtigen Halden erstreckt sich ... mehrDer Schacht 371 der ehemaligen SDAG Wismut befindet sich östlich der Straße zwischen Niederschlema und Hartenstein an dem großen Doppel-Bogen der Zwickauer Mulde. In der Nähe befindet sich das bekannte Ausflugsziel "Prinzenhöhle". Das Schachtgelände einschließlich der mächtigen Halden erstreckt sich vom Ostufer der Zwickauer Mulde zum einen über das fast vollständig verfüllte Kohlungsbachtal (Teilhalde 371/I) und zum anderen bis hin an die Felskuppen der Hohen Warte in ... ein Beitrag von Thomas Uhlig |
| Unser Einsteigerguide ist eine kleine Anleitung Dir selbst zu helfen oder richtig nach Hilfe zu fragen. Die passenden Informationen helfen Dir schnell eine Antwort zu erhalten und dem Fachmann Dir Auskunft zu erteilen. Nehme Dir bitte die 10 Minuten Zeit um den Guide durchzulesen. Ein lesenswerter B ... mehrUnser Einsteigerguide ist eine kleine Anleitung Dir selbst zu helfen oder richtig nach Hilfe zu fragen. Die passenden Informationen helfen Dir schnell eine Antwort zu erhalten und dem Fachmann Dir Auskunft zu erteilen. Nehme Dir bitte die 10 Minuten Zeit um den Guide durchzulesen. Ein lesenswerter Beitrag der Sammlergemeinschaft |